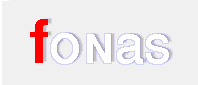Research Memorandum
In June 1998 the FONAS-Research Association published a joint memorandum with regard to the situation of science and peace research in Germany. This Research Memorandum is currently only available in German language and can be downloaded here. For further questions feel free to contact us.
Forschungsmemorandum
Forschungsverbund Naturwissenschaft, Abrüstung und internationale
Sicherheit (FONAS)
Mit einem Forschungsmemorandum möchte der "Forschungsverbund
Naturwissenschaft, Abrüstung und internationale Sicherheit (FONAS)" auf
wesentliche Forschungsdefizite und auf dringlichen Forschungsbedarf
hinweisen, der für die künftige sicherheits- und friedenspolitische
Entwicklung in Deutschland von zentraler Bedeutung ist. FONAS ist ein
Zusammenschluß von Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern,
die wissenschaftliche Fragen der Abrüstung, der Rüstungsbeschränkung und
der Nichtverbreitung an deutschen Hochschulen und an anderen
Forschungseinrichtungen bearbeiten.
Die in diesem Memorandum vorgeschlagenen Fördermaßnahmen sollen sowohl die
Erforschung von wissenschaftlichen Methodengrundlagen und Anwendungsfragen
als auch unabhängige Beiträge zur öffentlichen Debatte und Politikberatung
ermöglichen. Der Themenschwerpunkt der zu fördernden Arbeiten liegt im
Schnittfeld von naturwissenschaftlich-technischer Dynamik und
internationaler Sicherheit.
Das Memorandum richtet sich an politische Entscheidungsträger, an die
verantwortlichen Vertreter von Wissenschaft, Hochschulen und
Förderinstitutionen sowie an die interessierte Öffentlichkeit.
1. Forschungsbedarf und Forschungswirklichkeit
Naturwissenschaft und Technik spielen auch nach Ende des
Ost-West-Konfliktes eine herausragende Rolle für drängende Fragen der
Friedens- und Sicherheitspolitik sowie der Rüstungskontrolle. Die
Einbeziehung des Weltraums, die Elektronisierung und Automatisierung des
Gefechtsfeldes, die Entwicklung neuer Waffentypen und die Steigerung der
Präzision und Durchschlagskraft der Waffen verstärken erneut die
Rüstungsdynamik. Die Ausgaben für militärische und militärrelevante
Forschung und Entwicklung sind insbesondere in den führenden
Industrienationen, allen voran den USA, allenfalls geringfügig
zurückgegangen. Im Schatten einer nur quantitativen Abrüstung, bezogen auf
die Größe kampfbereiter Armeen und die Stückzahl zur Verfügung stehender
Waffensysteme, wird die qualitative Aufrüstung des nächsten Jahrhunderts in
den Forschungslabors vorbereitet. Die Entwicklungsdynamik in
Wissenschaftsgebieten wie der Bio- und Gentechnologie, der Informations-
und Kommunikationstechnologie, den Werkstoffwissenschaften, der
Mikroelektronik, der Nanotechnologie und der Nukleartechnologie lassen neue
oder fortentwickelte Waffensysteme und neue Bedrohungen erwarten. In den
USA spricht man von einer "Revolution im militärischen Bereich'', die jetzt
wissenschaftlich vorbereitet wird. Einen Eindruck der
militärtechnologischen Möglichkeiten der Zukunft und ihrer Folgewirkungen
gab bereits der Golfkrieg von 1991.
Auch im Bereich der Massenvernichtungswaffen kann alles andere als
Entwarnung gegeben werden. Die Aufrechterhaltung des Atomwaffenbesitzes und
die wissenschaftlich gestützte Verfeinerung der Nuklearwaffen durch einige
Kernwaffenstaaten wird ebenso vorangetrieben wie die Entwicklung
entsprechender Einsatzdoktrinen. Ein weiteres Warnsignal sind die indischen
und pakistanischen Atombombentests sowie die angestrebten Laborexperimente
und Computersimulationen der nunmehr acht Kernwaffenstaaten. Gleichzeitig
bemüht man sich international, die Bio- und Chemie-Waffenkonventionen
wirksamer und wasserdichter zu machen, u.a. durch Aufbau einer
naturwissenschaftlich absicherten Verifikation.
Angesichts der beschleunigten Entwicklung der qualitativen Rüstungsdynamik
sind naturwissenschaftlich abgestützte Analysen zur Klärung von tiefer
liegenden Zusammenhängen unerläßlich. Das vorrangige Ziel ist:
Eine unabhängige Forschung dieser Art ist in einigen wenigen Ländern bereits
etabliert, insbesondere in den USA. Dort veröffentlichte Analysen, die
unter herausragender Mitwirkung von Naturwissenschaftlern erstellt wurden,
haben seit Jahrzehnten einen erheblichen und unverzichtbaren Einfluß auf die
öffentliche Debatte. Beispielsweise wurden der internationalen
Staatengemeinschaft immer wieder schlüssige Vertragsvorschläge mitsamt einer
tiefgehenden Analyse zugehöriger Verifikationsmöglichkeiten vorgelegt oder
der US Congress und die Öffentlichkeit wurden auf drohende Instabilitäten
durch neue Waffensysteme hingewiesen.
In Deutschland konnte sich ähnliches bislang kaum etablieren. Zumindest
wurde Ende der achtziger Jahre durch ein spezielles Förderprogramm der
Volkswagen-Stiftung eine Anschubfinanzierung von entsprechenden
Forschergruppen an Universitäten in Bochum, Darmstadt und Hamburg
ermöglicht. Hier wurden bereits wichtige Beiträge zu Fragen der Abrüstung,
Rüstungsbeschränkung, Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen und
Verifikation von internationalen Abrüstungsverträgen erarbeitet. Dies läßt
sich nicht zuletzt daran messen, daß die entstandenen naturwissenschaftlich
orientierten Forschungsgruppen regelmäßig für die Politikberatung auf
Bundesebene angefragt wurden und auch in internationalen Foren starke
Beachtung finden (z.B. Überprüfungskonferenzen für den nuklearen
Nichtverbreitungsvertrag). Trotz dieser Erfolge ist es den vorhandenen
Förderinstitutionen bisher nicht gelungen, dieser langsam wachsenden neuen
Expertise eine beständige Infrastruktur in der deutschen
Forschungslandschaft zu schaffen. Bislang konnten nur drei
NaturwissenschaftlerInnen längerfristigere Stellen in entsprechenden
Forschungseinrichtungen antreten. Der Rest des inzwischen beachtlichen
Arbeitspensums kann nur über kurzfristige Projektmittel und spärlich
fließende Drittmittelquellen von einigen qualifizierten, aber immer wieder
stellenlosen WissenschaftlerInnen und durch Nebentätigkeit einiger
HochschullehrerInnen geleistet werden.
Vielversprechende Ansätze in unserem Land werden nun vom Forschungsverbund
Naturwissenschaft, Abrüstung und internationale Sicherheit e.V. (FONAS)
vertreten und der interessierten Öffentlichkeit gegenüber bekannt gemacht,
damit perspektivisch eine bessere Basis für diese Arbeit erreicht werden
kann. Mit diesem Engagement von NaturwissenschaftlerInnen, das in
interdisziplinäre Forschungszusammenhänge eingebettet ist, wird eine
spezifische Ergänzung der traditionell weitgehend
gesellschaftswissenschaftlich orientierten Friedens- und Konfliktforschung
angestrebt.
Mit wissenschaftlichen Arbeiten, die mathematische und
naturwissenschaftliche Methoden verwenden, sollen wegweisende Beiträge zu
Fragen von Abrüstung, Rüstungsbeschränkung und Nichtverbreitung geleistet
werden. Dies ist von hoher Relevanz, wenn der Übergang von einer Welt, die
durch die Blockkonfrontation und die atomare Abschreckung gekennzeichnet
war, in eine gerechtere Welt der friedlichen Konfliktaustragung gelingen
soll. Eine friedensfördernde Rolle deutscher Politik braucht die
Unterstützung durch unabhängige, naturwissenschaftlich orientierte,
interdisziplinäre Forschung zu Fragen der Abrüstung und internationalen
Sicherheit.
Es ist im allgemeinen und öffentlichen Interesse, daß eine solche Forschung
mit dauerhaft gesicherter Perspektive und in Unabhängigkeit, d.h.
weitgehend frei von direkten Regierungsaufträgen, durchgeführt werden kann.
Notwendig wäre eine institutionelle Förderung durch den Bund als
Hauptinteressent der Arbeitsergebnisse. Dies kann am ehesten durch eine
vorrangige Förderung hochschulischer Forschergruppen erreicht werden.
Zusätzlich ist - auch in Zeiten knapper Mittel - eine Unterstützung durch
die zuständigen Landesministerien erforderlich.
2. Forschungsagenda
Die als notwendig erachteten Forschungsarbeiten sind gekennzeichnet durch
ihre interdisziplinäre Anlage, ihren naturwissenschaftlichen Kern, die
Verbindung von Grundlagenwissen mit anwendungsnahen Fragestellungen und die
Orientierung an Problemlösungsstrategien.
Zu den verwendeten Methoden gehören theoretische und computergestützte
Berechnungen, Experimente im Labor und vor Ort, mathematische Modellierung
sowie die Sichtung und Analyse von Fachliteratur der verschiedensten
betroffenen Disziplinen.
Zu den wesentlichen Fragestellungen für die Forschung, die bearbeitet werden
können und sollen, gehören:
1. Vorschläge für Abrüstung und Rüstungsbeschränkung
3. Notwendigkeit von Förderkonzepten
Die bisher gewachsenen naturwissenschaftlichen Zusammenhänge konnten weder
in den Genuß der bereits 1983 ausgelaufenen Förderung der Deutschen
Gesellschaft für Friedens- und Konfliktforschung (DGFK) noch der seit 1993
auslaufenden Sonderförderungsprogramme der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) im Bereich Friedens- und Konfliktforschung kommen.1 Vor
allem dem Engagement der Volkswagen-Stiftung ist es zu verdanken, daß sich
überhaupt eine entsprechende neuartige Forschungsszene vorläufig etablieren
konnte.
Die Gründung von FONAS im Frühjahr 1996 erfolgte mit dem Ziel, die
wissenschaftliche Zusammenarbeit zu stärken und der Öffentlichkeit einen
verläßlichen Ansprechpartner zu geben. Regelmäßige Fachtagungen und
Arbeitssitzungen sorgen für eine zunehmende inhaltliche Vernetzung der
existierenden Forschergruppen. Halbjährliche Fachgespräche in Bonn dienen
der Arbeit an der Schnittstelle Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit.
Die Expertise der FONAS-Mitglieder ist inzwischen in der Bonner Politik
nachgefragt. Dies zeigt auch die Arbeit einiger FONAS-Mitglieder bei
Studienprojekten zur präventiven Rüstungskontrolle, die über das Büro für
Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) organisiert wurden.
Aus dem FONAS-Kreis wurden in den letzten Jahren 11 Doktorarbeiten und eine
Reihe von Diplomarbeiten abgeschlossen. Weitere Beiträge zur Lehre an den
Hochschulen wurden durch fachspezifische und interdisziplinäre Seminare und
Vorlesungen geleistet.
1998 gelang die Anbindung der Forschungsgruppen an eine wichtige
Fachgesellschaft, die Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG). Nachdem
seit 1995 mehrfach FONAS-Mitglieder die Organisation von Fachsitzungen zu
Abrüstung und Verifikation bei den Frühjahrtagungen der DPG übernommen
hatten wurde 1998 durch Beschluß des Vorstandsrates der DPG ein Arbeitskreis
``Physik und Abrüstung'' in der DPG eingerichtet.
Auf internationaler Ebene bestehen intensive Arbeitskontakte zu
einschlägigen Forschungsgruppen und -institutionen am Massachusetts
Institute of Technology, der Princeton University, der Harvard University
und der Union of Concerned Scientists (USA), sowie zu wissenschaftlichen
Arbeitsgruppen in Rußland, England, Schweden, Ungarn, den Niederlanden,
Pakistan und China. FONAS-Mitglieder haben internationale Konferenzen,
Workshops und Sommerschulen veranstaltet oder mitorganisiert. Zum Teil war
dies nur möglich durch die Unterstützung US-amerikanischer Stiftungen.
Forschungsergebnisse und beratender Sachverstand konnten bei Instituten und
Untergliederungen der Vereinten Nationen sowie bei den von der UN
veranstalteten Überprüfungskonferenzen wichtiger Rüstungskontrollverträge
eingebracht werden.
Diese langjährige Aufbauarbeit steht nun in Frage. Die Forschung kann nur
erhalten bleiben und sich weiterentwickeln, wenn eine langfristige
Finanzierung von Wissenschaftler- und Hochschullehrerstellen in dauerhaften
Projektzusammenhängen ermöglicht wird.
Die Beständigkeit einer unabhängigen Expertise im beschriebenen
Arbeitsbereich sollte vorrangig durch den Bund geschaffen werden. Dies
erscheint von der Themenstellung her angemessener, als nur auf das
Engagement der Länder zu vertrauen oder auf dasjenige der durch
Mittelkürzungen unter Druck geratenen Hochschulen zu setzen. Gleichwohl ist
die Hochschulforschung durch ein besonderes Maß an Unabhängigkeit
gekennzeichnet, was für eine stärkere Etablierung an den Hochschulen
spricht, und die Politik der Länder, die sich ihre föderal geregelten
Hoheiten im Forschungs- und Bildungsbereich stets sichern, sollten nicht
allzu schnell aus ihrer Verantwortung entlassen werden. Würde die
intendierte wissenschaftliche Arbeit dagegen weitgehend als
Auftragsforschung (etwa für einzelne Fachministerien des Bundes oder für die
Industrie) durchgeführt, wäre die Veröffentlichung der Ergebnisse nicht
gesichert und die Unabhängigkeit der Forschung laufend in Gefahr. Der
Vorteil der Förderung einer Forschung, die in hochschulische Kontexte
eingebunden ist, besteht auch in der Kombination von Forschung und Lehre,
die für eine beständige Fortentwicklung des Forschungsansatzes, für die
Verbreitung seiner Ergebnisse sowie für die Heranbildung des
wissenschaftlichen Nachwuchses dienlich ist. So ausgebildete
NaturwissenschaftlerInnen könnten beispielsweise in Fachgremien der
Bundesregierung, in Ministerien, in Abgeordnetenbüros, in internationalen
Organisationen oder in nichtstaatlichen Organisationen hervorragende Dienste
leisten.
Daher erscheint es angemessen, folgende Fördermaßnahmen auf
Bundesebene anzuregen:
Nur auf diese Weise können - aus unserer Sicht - unverzichtbare Beiträge
aus der Wissenschaft zur Politik der Friedenssicherung und Abrüstung
geleistet werden, die von einem unabhängigen
naturwissenschaftlich-technischen Sachverstand getragen sind.
23. Juni 1998
Dieser Text im im Adobe-PDF-Format:
FONAS-Forschungsmemorandum
Diese Anstrengungen von wissenschaftlicher Seite sind umso notwendiger, da
Abrüstung und Friedenssicherung weiterhin hochrangige Ziele der Politik
sind. Die dafür notwendige Forschung beinhaltet beispielsweise:
2. Technische Mittel und Verfahren zur Verifikation und
Friedenserhaltung
3.Qualitative und vorbeugende Rüstungskontrolle und
Rüstungsbeschränkung
4. Konversion militärischer Hochtechnologie
5. Modellierung komplexer Systeme
6. Zusammenhänge von globaler Umweltveränderung mit
internationaler Sicherheit
Daneben sind zusätzliche Maßnahmen zu empfehlen, die der Stabilisierung und
Wirksamkeit der intendierten längerfristiger ausgerichteten
Forschungszusammenhänge dienlich sind:
Die Eröffnung von Wegen zur Förderung einer naturwissenschaftlich
orientierten Abrüstungs- und Rüstungskontrollforschung auf Bundesebene, auf
Länderebene und durch weitere Forschungsförderinstitutionen ist unserer
Meinung nach unabdingbar. Insbesondere die Bundespolitik ist hier
herausgefordert, entsprechende und angemessene Förderinstrumente zu
schaffen.